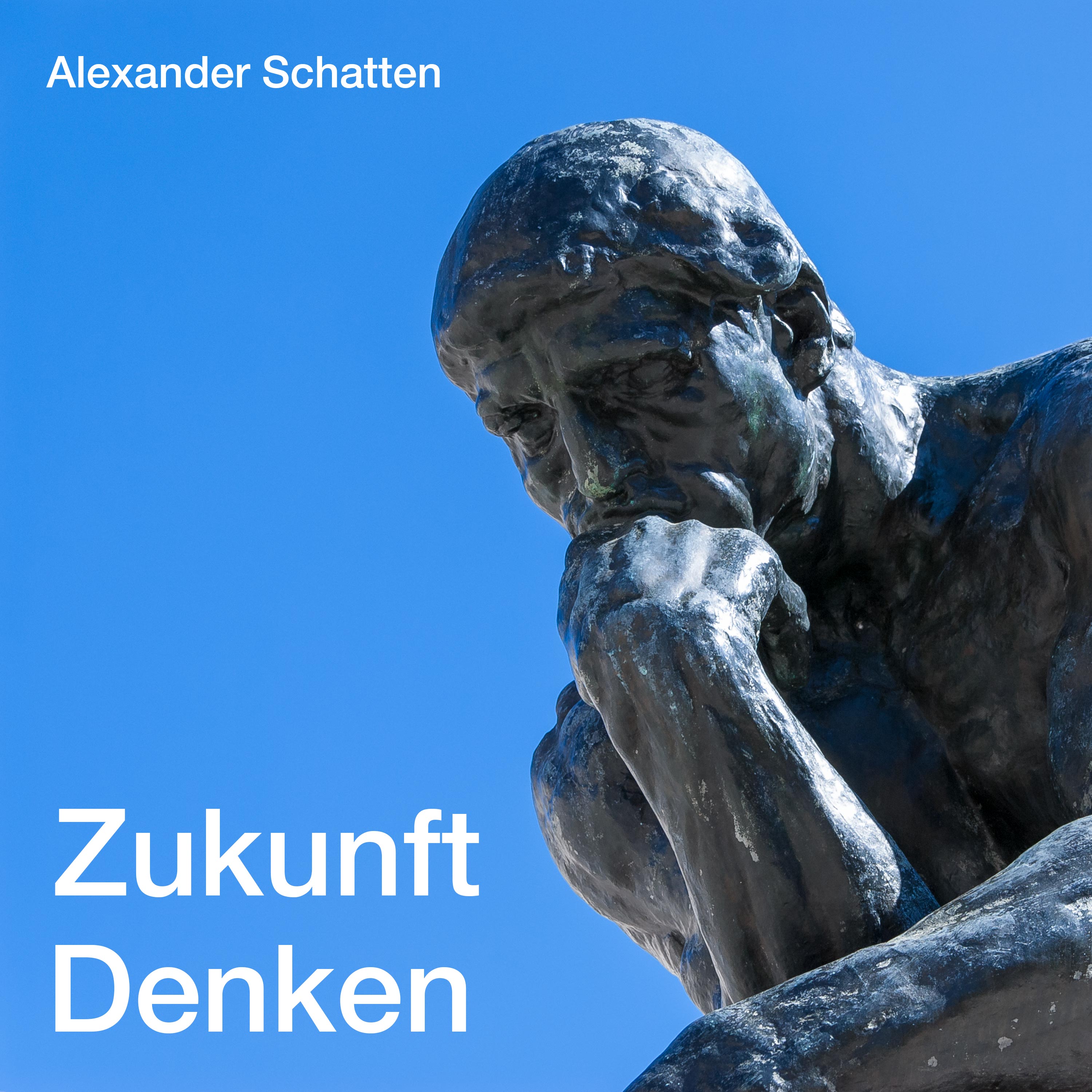Episodes

Monday Jul 14, 2025
129 — Rules, A Conversation with Prof. Lorraine Daston
Monday Jul 14, 2025
Monday Jul 14, 2025
The title of today’s episode is “Rules.” The term “rules” encompasses a variety of concepts, including algorithms, maxims, principles, models, laws, regulations, and even laws of nature. In essence, rules shape our world and our lives. My guest for this conversation is Prof. Lorraine Daston.
Lorraine Daston is Director Emerita at the Max Planck Institute for the History of Science in Berlin, a Permanent Fellow of the Wissenschaftskolleg zu Berlin, and a Visiting Professor in the Committee on Social Thought at the University of Chicago. After studying at Harvard and Cambridge Universities, she taught at Princeton, Harvard, Brandeis, Chicago, and Göttingen Universities before becoming one of the founding directors of the Max Planck Institute for the History of Science in Berlin, serving from 1995 until her retirement in 2019. She has published extensively on topics in the history of science, including probability, wonders, objectivity, and observation. She is a member of the American Academy of Arts and Sciences, the American Philosophical Society, the Leopoldina National Academy of Germany, and a corresponding member of the British Academy.
One of her recent books, titled Rules — the namesake of this episode — will be at the center of our discussion. For our German audience, a German translation of this book is also available.
This episode has another inspiring connection: in Episode 120, I spoke with her husband, Prof. Gerd Gigerenzer. If you are German-speaking, I highly recommend listening to both episodes, as you’ll find a number of overlapping and complementary topics and ideas.
We start with tie question: what are rules, algorithms, maxims, principles, models, laws, regulations — and why such a wide net was cast in the book.
»One way of thinking about rules is to think about them along the axis of specificity versus generality.«
What are thick and thin rules then? Is this a second axis, perpendicular perhaps, to the previous? When are we supposed to exercise judgement — or is a rule supposed to cover all circumstances? How does an unstable and unpredictable world fit into this landscape of rules?
“No rules could be given to oversee when and how rules could be legitimately broken without an infinite regress of rules, meta-rules, meta-meta-rules, and so on. At some point, executive discretion must put an end to the series, and that point cannot be foreseen.”
What about Immanuel Kant and his book titles?
Did our lives become more or less predictable?
»Seit der Antike gilt: es ist egal wann sie geboren sind oder sterben, es läuft immer dasselbe Stück – Dies stimmt seit 200 Jahren nun nicht mehr.«, Peter Sloterdijk
Is the assumption correct that in the past lives were very unpredictable in the short term but rather predictable in the mid and long term, where this is the opposite today?
What can we learn from the rule of St. Benedikt?
Why is it impossible to define rules without exceptions and judgement — what is Wittgensteins example?
“Even what seems to us a straightforward rule — does require interpretation. […] We cant simply solve the problem of rule following by adding meta-rules of interpretation. This is a procedure which will go on to infinity.”
Why is this a deep and fundamental problem for bureaucracies? What happens if rules get overbearing?
How do we teach rules? Why is “rule as model” an important concept? How do we know that we mastered something?
»I think typical of the things we do best that we are no longer conscious of doing them«
What is the relation between power and rules? We makes the rules, who executes the rules and who has to follow the rules?
“sovereignty as the power to decide on the exception” Carl Schmitt
The German scientist Thomas Bauer asks the question: Did we loose are tolerance for ambiguity?
»Wer Eindeutigkeit erstrebt, wird darauf beharren, dass es stets nur eine einzige Wahrheit geben kann und dass diese Wahrheit auch eindeutig erkennbar ist.«
»Nur dann, wenn etwas rein ist, kann es eindeutig sein.« Thomas Bauer
What is the connection between tolerance for ambiguity and trust?
»There is something really quite strange going on here about this voracios appetite for control, predictability and certainty. The more you have, the more you want.«
Does the desire for purity lead to moralistic arguments and dogmatism? What can we learn from Francois-Jacques Guillote and total surveillance and control in the 18th century and today?
»The more you try to close the loop holes, the more loop holes you create«
What do we learn from all that about the modern world? Do complex societies/organisations need more or less rules? How should these rules be designed?
»It's much better to have a system which has very few rules and the rules are formulated as general principles.«
Roger Scruton asks a fundamental question: What comes first, rules or order?
»We should always remember that legislation does not create legal order but presupposes it.«
What is the relation between knowlesge and power (of rules)?
»It is far easier to concentrate power than to concentrate knowledge.«, Tom Sowell
What about »laws of nature« — how do they fit into the picture of rules? Why do we call regularities of nature »laws«? Can god change the laws of nature? What did Leibniz have to say about that question?
»Something which is entirely without precedent and without any kind of reference to a previously existing genre often just appears chaotic to us.«
And finally, what do rules mean for culture and entertainment? Is there entertainment without rules? Do rules trigger creativity?
»Much as we complain about rules, much as we feel stifled by rules, we nonetheless crave them. […] one definition of culture is: culture and rules are the same thing,«
Is individual freedom in an over-regulated society even possible? Have we traded alleged safety for freedom? Will we finally make the important steps back to accountability and further to resposibility?
Other Episodes
-
Episode 122: Komplexitätsillusion oder Heuristik, ein Gespräch mit Gerd Gigerenzer
-
Episode 126: Schwarz gekleidet im dunklen Kohlekeller. Ein Gespräch mit Axel Bojanowski
-
Episode 123: Die Natur kennt feine Grade, Ein Gespräch mit Prof. Frank Zachos
-
Episode 118: Science and Decision Making under Uncertainty, A Conversation with Prof. John Ioannidis
-
Episode 116: Science and Politics, A Conversation with Prof. Jessica Weinkle
-
Episode 110: The Shock of the Old, a conversation with David Edgerton
-
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
-
Episode 90: Unintended Consequences (Unerwartete Folgen)
-
Episode 79: Escape from Model Land, a Conversation with Dr. Erica Thompson
-
Episode 58: Verwaltung und staatliche Strukturen — ein Gespräch mit Veronika Lévesque
-
Episode 55: Strukturen der Welt
-
Episode 50: Die Geburt der Gegenwart und die Entdeckung der Zukunft — ein Gespräch mit Prof. Achim Landwehr
References
-
Prof. Lorraine Daston
- Selected Books by Prof. Daston
-
Lorraine Daston, Regeln: Eine kurze Geschichte, Suhrkamp (2023)
-
Lorraine Daston, Rules: A Short History of What We Live By, Princeton Univ. Press (2022)
-
Lorraine Daston, Peter Galison, Objectivity, MIT Press (2010)
-
Lorraine Daston, Against Nature, MIT Press (2019)
-
Lorraine Daston, Katharine Park, Wonders and the Order of Nature, 1150-1750, Zone Books (2001)
-
Lorraine Daston, Rivals: How Scientists Learned to Cooperate, Columbia Global Reports (2023)
-
-
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (1781)
-
Immanuel Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (1783)
-
Thomas Bauer, Die Vereindeutigung der Welt: Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. Reclam (2018)
-
Roger Scruton, How to be a Conservative, Bloomsbury Continuum (2014)
-
Thomas Sowell, intellectuals and Society, Basic Books (2010)

Tuesday Jun 10, 2025
126 — Schwarz gekleidet im dunklen Kohlekeller. Ein Gespräch mit Axel Bojanowski
Tuesday Jun 10, 2025
Tuesday Jun 10, 2025
Das ist ein Gespräch, das mir sehr viel Spaß gemacht. Axel Bojanowski und ich haben gleich zu Beginn der virtuellen Session losgelegt und diskutiert, bis ich dann den Notstopp ziehen musste — schließlich sollte das eine Podcast-Folge werden und nicht nur eine höchst interessante Diskussion unter vier Augen.
Der Titel dieser Folge ist vielleicht kurios, aber mir ist das Zitat von Karl Popper aus den 1980er Jahren eingefallen:
»Wissenschaft ist, wenn man schwarz gekleidet in einem dunklen Kohlenkeller nach einer schwarzen Katze sucht, von der man gar nicht weiß, ob sie existiert.«
Davon leiten sich alle möglichen Folgen ab, unter anderem, dass Wissenschaft immer von Annahmen geprägt ist. Sie ist auch mit zum Teil großer Unsicherheit verbunden. Viel Bescheidenheit und Selbstkritik wären in der Interpretation und Darstellung notwendig.
Davon ist in der heutigen Welt nicht viel zu finden. Besonders nicht Bescheidenheit und kritische, kluge Reflexion als Fundament unserer politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen, eher aktivistische Grabenkämpfe, die mehr mit dem Circus Maximus als mit Expertenwesen zu tun haben.
Wir behandeln folglich in dieser Episode Qualitätsprobleme in der Wissenschaft, Aktivismus, die Rolle von Journalisten und Medien, Anreizsysteme, welche Themen in der Wissenschaft überhaupt diskutiert werden und von wem. Außerdem, welchen Schaden wir anrichten, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, in kritischen Zeiten Ideen klug zu reflektieren und was wir mit unseren Kindern und Jugendlichen machen, wenn wir sie ständig mit apokalyptischen Visionen konfrontieren.
Wo sind wir also falsch abgebogen? Was können wir alle tun, damit wir ein positives Bild der Zukunft entwickeln können und wir wieder darüber sprechen, wie wir Fortschritt erzielen können und nicht nur ständig im defätistisch/apokalyptischen Denken stecken bleiben.
Ich sollte an dieser Stelle nicht vergessen, meinen Gast vorzustellen, auch wenn ihn die meisten sicher schon kennen: Axel Bojanowski diplomierte an der Universität Kiel über Klimaforschung. Seit 1997 arbeitet er als Wissenschaftsjournalist, u. a. für "Die Zeit", "Nature Geoscience", "Geo", "Stern" und der "Süddeutschen Zeitung". Er war Redakteur beim "Spiegel" , dann Chefredakteur bei "Bild der Wissenschaft" und "Natur". Seit August 2020 ist er Chefreporter für Wissenschaft bei "WELT". Bojanowski hat fünf Sachbücher verfasst. Der Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler hat ihn 2024 für seine publizistischen Leistungen ausgezeichnet.
Aus meiner persönlichen Sicht ist Axel Bojanowski einer der besten Wissenschaftsjournalisten, die ich kenne. Gerade im deutschsprachigen Raum würden wir viel mehr Journalisten seiner Güte dringend benötigen. Er hat auch zwei wichtige und sehr zugängliche Bücher geschrieben, deren Themen natürlich in diesem Gespräch auch thematisiert werden.
Wir beginnen mit der Frage, wie die Qualität wissenschaftlicher Aussagen zu beurteilen ist. Wird es immer schwieriger zu erkennen, was ernsthafte Wissenschaft und was irrelevant, falsch oder Ideologie oder Aktivismus ist?
»Science und Nature sind mittlerweile journalistische Produkte. Letztlich gelten sie als die wichtigsten Impact-Magazine für die Wissenschaft, aber eigentlich funktionieren sie nach den Gesetzen von Massenmedien.«
Es wird so getan, als ob es vollkommen klar wäre, wie man den Klimawandel begrenzt. Es wird nicht verstanden oder aufgegriffen, dass es sich um komplexe Zielkonflikte handelt.
»The time for debate has ended.« Marcia Nutt
Funktionieren journalistische Medien heute immer stärker so, dass es um persönliche Absicherung geht, indem man Nachrichten publiziert, von denen man annimmt, dass sie dem aktuellen Zeitgeist entsprechen und somit sozial erwünscht sind?
»Wenn man Artikel dieser Art bringt, hat man nichts zu befürchten.«
Welche Geschichten erzählen wir uns als Gesellschaft und unseren Kindern und Jugendlichen?
»Es handelt von weitgehend ignorierten Sensationen der jüngeren Menschheitsgeschichte der letzten 200 Jahre, also von der Industrialisierung und ihren Folgen, die die Welt besser gemacht haben, als die meisten Leute ahnen. Diese Geschichten werden kaum erzählt.«
Erleben wir aktuell ein Multiorganversagen der wesentlichen Strukturen und Institutionen, die unsere moderne Zivilisation bisher ermöglicht haben?
»Covid war sozusagen Klimadebatte im Schnelldurchlauf.«
Sollten in einer Krise nicht verschiedene kluge Ideen unterschiedlicher Art diskutiert und abgewogen werden?
»Es wurde ganz schnell verlangt, sich einem Lager zuzuordnen. Wenn man das nicht eindeutig selbst tut, dann wird man in ein Lager eingeordnet.«
Was ist der Zusammenhang von Risiko, Unsicherheit und welche Entscheidungen folgen aus wissenschaftlicher Erkenntnis?
»Man hat bei Covid wie beim Klima hohe Risiken mit mit großen Unsicherheiten verbunden.[…] Dann wird aber so getan als ob es eindeutig wäre und man im Grunde ganz klare Fakten aus der Wissenschaft bekäme und Handlungsanweisungen — was nie der Fall ist. Aus wissenschaftlichen Fakten folgen keine Handlungensanweisngen. Nie.«
Gibt es tatsächlich immer nur die eine richtige Antwort auf ein Problem, follow the science — alternativlos?
»Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, auf dieses Problem zu reagieren [Klima, Covid|. Es ist letztlich eine Wertefrage.«
Finden wir immer wieder dieselbe Lagerbildung vor, die aber aus anderen »Quellen« gespeist ist, etwa Technologieoptimisten vs. -pessimisten, Liberale vs. Etatisten, und dergleichen? Das ist sehr ungünstig, denn:
»Wissenschaft ist nun mal der beste Erkenntnisprozess, den wir haben. […] Um Wissenschaft richtig zu verstehen, müsste man aber Unsicherheiten immer klar mitkommunizieren.«
Ist es besser, eine falsche Karte oder gar keine Karte zu haben, wenn man eine Wanderung unternimmt?
»Es geht auf diesen Ebenen [wissenschaftliche Prozesse] immer auch um Macht, das darf man nicht vergessen. Wenn man es versäumt, sich auf die Seite zu schlagen, die den Ton angibt, dann verliert man an Einfluss.«
Im Journalismus wurde jede Form der Differenzierung sofort bekämpft. Wie kann man aber als Gesellschaft unter solchen Bedingungen bei komplexen Herausforderungen klug entscheiden?
Wissenschaft und Journalismus sollten aber beide Prozesse der Wahrheitsfindung sein. Betonung liegt dabei auf »Prozess« — was bedeutet dies für die praktische Umsetzung?
Werden Opportunismus und Feigheit, seine eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen, zur größten Bedrohung unserer Gesellschaft?
»Journalisten sind vor allem feige.«
Wie sollten wir mit Unsicherheiten umgehen?
»Die Unsicherheiten aber, und das ist ein wichtiger Punkt, können gerade nicht beruhigen. Es sind die Unsicherheiten, ein Problem an sich.«
Gibt es nur umstrittene und irrelevante Wissenschafter?
Falsche Prognosen und Aussagen in der Öffentlichkeit haben für opportunistische Wissenschafter auch fast nur positive Seiten und werden in der Praxis kaum bestraft. Sie können dieselben falschen Ideen über Jahrzehnte breit publik machen und werden auch noch belohnt — weil sie ja vermeintlich auf der »richtigen« Seite stehen.
Die grundlegende Frage dahinter scheint zu sein: Welche Geschichten erzählt sich eine Gesellschaft, von welchen wird sie geleitet, welche sind konstitutiv für ihre Kultur und wie können wir diese ändern, um damit wieder einen positiven Blick auf die Zukunft zu bekommen?

Nadelöhre der Wissenschaft
Die Universitäten haben sich, wie auch die Medien, immer weiter homogenisiert — von Vielfalt leider keine Spur.
»Das Milieu verstärkt sich selbst.«
Was bedeutet das, etwa am Beispiel der Attributionsforschung? Was bedeutet dies für große politische Projekte, wie die deutsche Energiewende, die nicht nur im großen Maßstab gescheitert ist, sondern auch Deutschland schwer beschädigt hat. Wer trägt dafür nun die Verantwortung? Und die Medien stimmen alle das gleiche Lied an, ohne kritisch zu hinterfragen — warum eigentlich?
»Man guckt gar nicht mehr, was stimmt, sondern: Was schreiben die anderen?«
Warum ist es so schwer bei Klimafragen, die Fakten korrekt darzustellen? Aktuell wird von Politik und Aktivisten ständig betont, dass es viele Hitzetote gäbe. Es wird nicht erwähnt, dass es zehnmal so viele Kältetote gibt:
»Across the 854 urban areas in Europe, we estimated an annual excess of 203 620 deaths attributed to cold and 20 173 attributed to heat.«, Pierre Masselot et al
Diese einseitige Propaganda wird überall in der Gesellschaft verbreitet, auch an den Schulen:
»Papa, wenn der Meeresspiegel steigt, sterben wir?!«
Was richten wir mit unseren Kindern an?
»Der Erfolg der menschlichen Zivilisation beruht darauf, dass man sich von der Natur unabhängig gemacht hat und dass man die Natur auch für sich genutzt hat. […] Diese Geschichten des Fortschritts sind wichtig zu verstehen; gerade für Kinder!«
Wir leben nicht, wir sterben in Harmonie mit der Natur:
»Have you heard people say that humans used to live in balance with nature? […] There was a balance. It wasn’t because humans lived in balance with nature. Humans died in balance with nature. It was utterly brutal and tragic.«, Hans Rosling
Erst seit rund 100 Jahren können wir davon sprechen, dass Menschen ansatzweise in modernem Lebensstandard leben.
»Wir zogen in die Stadt zu einem alten Ehepaar in eine kleine Kammer, wo in einem Bett das Ehepaar, im andern meine Mutter und ich schliefen. Ich wurde in einer Werkstätte aufgenommen, wo ich Tücher häkeln lernte; bei zwölfstündiger fleißiger Arbeit verdiente ich 20 bis 25 Kreuzer im Tage. Wenn ich noch Arbeit für die Nacht nach Hause mitnahm, so wurden es einige Kreuzer mehr. Wenn ich frühmorgens um 6 Uhr in die Arbeit laufen mußte, dann schliefen andere Kinder meines Alters [ca. 11 Jahre] noch.«
»Es war ein kalter strenger Winter und in unsre Kammer konnten Wind und Schnee ungehindert hinein. Wenn wir morgens die Tür öffneten, so mußten wir erst das angefrorene Eis zerhacken, um hinaus zu können, denn der Eintritt in die Kammer war direkt vom Hof und wir hatten nur eine einfache Glastür. Heizen konnten wir daheim nicht, das wäre Verschwendung gewesen, so trieb ich mich auf der Straße, in den Kirchen und auf dem Friedhof herum.«, Adelheid Popp ca. 1890
Ist der Mensch das Krebsgeschwür des Planeten? Was passiert, wenn wir über Jahrzehnte solche Narrative in Schulen, Universitäten und Medien verbreiten? Wird der Fortschritt paradoxerweise von denen bekämpft, die fortgeschritten sind? Welches eigenartige und ethisch fragwürdige Signal senden wir da an den Rest der Welt?
»Elend bedarf keiner Erklärung. Das ist der Normalfall. Wohlstand bedarf der Erklärung.«
Wir scheinen aber in einer Zeit zu leben, wo Wohlstand, zumindest für einige, so normal geworden ist, dass man jedes Gefühl für die realen Prozesse der Welt verlernt hat und ignoriert. Wo man selbst die vermeintlich wichtigsten eigenen Ziele obskuren Ideologien opfert:
»Zu Zeiten, wo der Klimawandel angeblich das größte Problem ist, schaltet man klimafreundliche Kernkraftwerke ab.«
Warum findet die Diskussion komplexer Phänomene so gespalten und so feindselig und gleichzeitig so pseudo-elitär statt?
Wie das gut gemeinte Definieren von simplistischen Indikatoren das Gegenteil des gewünschten Ziels erreichen kann. Aus einem Indikator wird ein Götz, dem bedingungslos in den Untergang gefolgt wird. Klimaschutz nur mit Wind und Sonne ist eine Irreführung deutscher Aktivisten und gedankenloser Politik. Oder ist es vielmehr eine bait and switch Strategie? Man lockt mit dem einen, tauscht es dann aber durch eine andere Sache aus? Man lockt mit Klimawandel, möchte aber tatsächlich eine radikale politische Wende erzielen?
Der Gipfel der Ideologie: ein Giga-Projekt wie die »Energiewende« ganz bewusst ohne Kostenkontrolle? Ein Bürger stellt eine Anfrage:
»Zunächst dürfen wir anmerken, dass die Bundesregierung keine Gesamtkostenrechnung zur Energiewende unternimmt.«, Frage den Staat (2023)
Damit bleibt noch eine grundlegende Frage: Wer soll, oder genauer, wer kann eigentlich die Verantwortung für die komplexen Entscheidungen der heutigen Zeit tragen? Soll eine Expertokratie die Welt retten, oder sind es letztens nur die Menschen selbst, die diese Verantwortung tragen müssen?
Referenzen
Andere Episoden
-
Episode 125: Ist Fortschritt möglich? Ideen als Widergänger über Generationen
-
Episode 120: All In: Energie, Wohlstand und die Zukunft der Welt: Ein Gespräch mit Prof. Franz Josef Radermacher
-
Episode 118: Science and Decision Making under Uncertainty, A Conversation with Prof. John Ioannidis
-
Episode 116: Science and Politics, A Conversation with Prof. Jessica Weinkle
-
Episode 112: Nullius in Verba — oder: Der Müll der Wissenschaft
-
Episode 109: Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr
-
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
-
Episode 106: Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
-
Episode 96: Ist der heutigen Welt nur mehr mit Komödie beizukommen? Ein Gespräch mit Vince Ebert
-
Episode 94: Systemisches Denken und gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Gespräch mit Herbert Saurugg
-
Episode 93: Covid. Die unerklärliche Stille nach dem Sturm. Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
-
Episode 91: Die Heidi-Klum-Universität, ein Gespräch mit Prof. Ehrmann und Prof. Sommer
-
Episode 86: Climate Uncertainty and Risk, a conversation with Dr. Judith Curry
-
Episode 80: Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion
-
Episode 76: Existentielle Risiken
-
Episode 74: Apocalype Always
Axel Bojanowski
- Axel Bojanowski, Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten: Der Klimawandel zwischen Lobbygruppen und Wissenschaft, Westend (2024)
- Axel Bojanowski, 33 erstaunliche Lichtblicke, die zeigen, warum die Welt viel besser ist, als wir denken, Westend (2025)
- Homepage Axel Bojanowski
- Substack
- Die Welt
- Twitter/X
Fachliche Referenzen
- Marcia McNutt, The beyond-two-degree inferno, Science Editorial (2015)
- Patrick Brown, Do Climate Attribution Studies Tell the Full Story? (2025)
- Roger Pielke Jr., What the media won't tell you about ... hurricanes (2022)
- Roger Pielke Jr., Making Sense of Trends in Disaster Losses (2022)
- Roger Pielke Jr., What the media won't tell you about . . . Drought in Western and Central Europe (2022)
- Rob Henderson, 'Luxury beliefs' are latest status symbol for rich Americans (2019)
- Bernd Stegemann, Die Klima-Gouvernanten und ihre unartigen Zöglinge (2025)
-
Steven Koonin, Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters, BenBella Books (2021)
- Hart aber Fair (Sonja Flaßpöhler) (2021)
- Pierre Masselot et al, Excess mortality attributed to heat and cold; 854 cities in Europe, Lancet Planet Health (2023)
- Hans Rosling, Factfulness, Sceptre (2018)
- Adelheid Popp, Jugendgeschichte einer Arbeiterin (1909)
- Axel Bojanowski, Scheuklappen der Klimaforschung (2024)
- Frag den Staat: Kosten der Energiewende von 2000 bis 2022 (2023)

Sunday May 04, 2025
123 — Die Natur kennt feine Grade, Ein Gespräch mit Prof. Frank Zachos
Sunday May 04, 2025
Sunday May 04, 2025
Der wunderbare Titel der heutigen Episode lautet: »Die Natur kennt feine Grade«. Leider stammt er nicht von mir, sondern ist der Titel des neuen Buches meines heutigen Gasts, Prof. Frank Zachos. Aufmerksame Hörer werden sich an Frank erinnern, dazu aber mehr später.
Frank Zachos ist seit 2011 Wissenschaftler am Naturhistorischen Museum in Wien und außerdem externer Professor an der Universität in Bloemfontein in Südafrika. Er hat Biologie, Philosophie und Wissenschaftsgeschichte studiert und beschäftigt sich außer mit Zoologie und Evolutionsbiologie auch mit theoretischen und philosophischen Aspekten der Biologie.
In dieser Episode beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Beiträge Naturwissenschaft im Allgemeinen und Biologie im Besonderen bei fundamentalen Fragen des Menschseins leisten kann. Wir beginnen dabei mit den bekannten Kant'schen Fragen:
- Was kann ich wissen? (Erkenntnistheorie)
- Was darf ich hoffen? (Religionsphilosophie)
- Was soll ich tun? (Ethik / Moralphilosophie)
- Was ist der Mensch? (Anthropologie im weitesten Sinne)
Und zu allen Fragen gibt es, wir wir erkunden werden, eine biologische Dimension. Zahlreiche Fragen werden aufgeworfen: Wie unterscheiden sich Mensch und Tier? Welche Rolle spielt Evolution in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens, von der Biologie, über die Erkenntnis bis zur Kultur? Was können wir für Moral und Ethik von der Biologie lernen? Was ist die evolutionäre Erkenntnistheorie (die besonders auch in Österreich wichtige Vertreter hatte)? Wir blicken hier zurück auf Konrad Lorenz und Rupert Riedl.
Kann man der Philosophie in den Naturwissenschaften entkommen, oder holt sie uns immer ein?
»Man kann die Philosophie ignorieren, man kann ihr aber nicht entkommen«
Was ist der Unterschied zwischen unwissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Fragestellungen? Was ist metaphysischer Realismus, und warum lässt sich dieser wissenschaftlich nicht begründen. Welche Rolle spielt systemisches Denken in Ergänzung zum Reduktionismus für die komplexen Herausforderungen der Zeit und warum kann biologisches Denken ebenfalls hilfreich sein?
»Wer will was Lebendigs erkennen und beschreiben,
Sucht erst den Geist herauszutreiben,
Dann hat er die Teile in seiner Hand,
Fehlt, leider! nur das geistige Band.«,
Goethe, Faust I
Behaupten wir oft mehr zu wissen und zu verstehen als wir wirklich tun? Warum ist intellektuelle Bescheidenheit gerade heute von zentraler Bedeutung.
»Die Wissenschaft ist gewissermaßen Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden«
Gibt es Kränkungen der Menschheit durch Wissenschaft? Gibt es bei manchen oder gar vielen Menschen eine Art der Realitätsfurcht?
Was hat »Follow the Science« ausgelöst, also vor rund 100 Jahren Euthanasie und die Verbesserung der Erbsubstanz des Menschen als Stand des Wissens galt?
»Wann immer man Moral mit wissenschaftlichen Erkenntnissen letztbegründen will, wird es ganz gefährlich«
Frank erinnert dabei wieder an Kant:
»Es gibt kein Sollen in der Natur.«
Womit sich die Frage stellt, was ein naturalistischer Fehlschluss ist, und wie wir ihn vermeiden können?
»Wer zwingt uns natürlich zu sein?«
Oder wie es Hans Rosling ausdrückt:
»Have you heard people say that humans used to live in balance with nature? […] There was a balance. It wasn’t because humans lived in balance with nature. Humans died in balance with nature. It was utterly brutal and tragic.«
Kehren wir zurück zur Erkenntnis: was können wir aus der Biologie über Erkenntnisfähigkeit lernen? Konkreter gedacht am Beispiel der evolutionären Erkenntnistheorie sowie den Kant'schen a prioris.
»Das was im Idividuum a priori ist (also von Geburt an), ist eigentlich doch etwas erlerntes, aber nicht individuell erlernt, sondern evolutionär/stammesgeschichtlich. Das Kant'sche a priori wird in der evolutionären Erkenntnistheorie zu einem phylogenetischen oder evolutionären a posteriori.«
Nicht zuletzt diskutieren wir auch über die Bedeutung von Religion für die Menschen. Verschwindet Religion langsam, wenn unsere Erkenntnisse über die Welt zunehmen, oder passiert eher das Gegenteil?
Und damit reißen wir die Fragen die in Franks Buch aufgeworfen werden, nur an. Daher an alle Zuhörer dieser Episode, die Empfehlung, sich das Buch zu besorgen und weiterzulesen.
»Wir können mittlerweile Dinge beschreiben, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können«
Referenzen
Frank Zachos
Andere Episoden
-
Episode 118: Science and Decision Making under Uncertainty, A Conversation with Prof. John Ioannidis
-
Episode 106: Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
-
Episode 98: Ist Gott tot? Ein philosophisches Gespräch mit Jan Juhani Steinmann
-
Episode 92: Wissen und Expertise Teil 2
-
Episode 85: Naturalismus — was weiß Wissenschaft?
-
Episode 83: Robert Merton — Was ist Wissenschaft?
-
Episode 75: Gott und die Welt, ein Gespräch mit Werner Gruber und Erich Eder
-
Episode 55: Strukturen der Welt
-
Episode 48: Evolution, ein Gespräch mit Erich Eder
-
Episode 41: Intellektuelle Bescheidenheit: Was wir von Bertrand Russel und der Eugenik lernen können
-
Episode 33: Naturschutz im Anthropozän – Gespräch mit Prof. Frank Zachos
Fachliche Referenzen
- Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (1781)
- Immanuel Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (1783)
- Konrad Lorenz, Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit, Piper (1996)
- Rupert Riedl, Evolution und Erkenntnis, Piper (1985)
- Rupert Riedl, Strukturen der Komplexität: Eine Morphologie des Erkennens und Erklärens, Springer (2000)
- Johann Wolfgang von Goethe, Faust I (1808)
- Hans Rosling, Factfulness, Sceptre (2018)
- Konrad Lorenz Artikel: Die Lehre Kants a priori im Lichte der modernen Biologie.
-
Dave Grossman, On Killing, Back Bay Books (2009)

Thursday Apr 17, 2025
122 — Komplexitätsillusion oder Heuristik, ein Gespräch mit Gerd Gigerenzer
Thursday Apr 17, 2025
Thursday Apr 17, 2025
Auch heute freue ich mich wieder darüber, einen äußerst kompetenten und prominenten Gast vorstellen zu dürfen: Prof. Gerd Gigerenzer. Das Thema ist eines, das uns seit einiger Zeit begleitet, und auch noch weiter begleiten wird, denn es gehört zu den wesentlichsten Fragen der heutigen Zeit. Werden wir von der stetig steigenden Komplexität in unserer Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft überrollt, oder gelingt es, Mechanismen zu entwickeln, trotzdem kluge und resiliente Entscheidungen zu treffen? Entscheidungen, die uns auch helfen, mit komplexen Risiken umzugehen?
Gerd Gigerenzer war unter anderem langjähriger Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, ist Direktor des Harding Center for Risk Literacy an der Universität Potsdam, Partner von Simply Rational - The Institute for Decisions und Vizepräsident des European Research Council (ERC). Er ist ehemaliger Professor für Psychologie an der Universität von Chicago und John M. Olin Distinguished Visiting Professor, School of Law an der Universität von Virginia. Darüber hinaus ist er Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Deutschen Akademie der Wissenschaften und der British Academy sowie Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Sciences und der American Philosophical Society. Er hat unzählige Preise gewonnen sowie zahlreiche Bücher geschrieben, die nicht nur inhaltlich höchst relevant sondern zudem auch noch sehr zugänglich für eine breite Leserschicht sind.
Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen:
- Entscheidungen unter Unsicherheit und Zeitbeschränkung
- Risikokompetenz und Risikokommunikation
- Entscheidungsstrategien von Managern, Richtern und Ärzten
Und genau über diese Themen werden wir uns in der Episode unterhalten. Wie geht man in Situationen großer Unsicherheit mit Daten und Informationen um?
»Je größer die Unsicherheit ist, desto mehr Informationen muss man ignorieren.«
Was ist eine Heuristik, und welche Heuristiken wenden wir erfolgreich in welchen Situationen an?
»In Situationen von Unsicherheit, verlassen sich Menschen nicht auf die ganze Vergangenheit, sondern auf die jüngste Vergangenheit — das nennt man recency Heuristik.«
Warum führen mehr Daten nicht immer zu besseren Entscheidungen?
»Ein Datenpunkt, gut gewählt, erlaubt [in vielen Fällen] bessere Vorhersagen als Big Data«
Was ist Intuition und unter welchen Umständen ist intuitives sinnvoller als vermeintlich rationales Entscheiden?
»Intuition ist keine Willkür. Intuition ist gefühltes Wissen, das auf jahrelanger Erfahrung beruht.«
Was ist von den neuen Theorien der Rationalität, z. B. dem System 1 und 2 von Kahnemann zu halten?
»The abject failure of models in the global financial crisis has not dented their popularity among regulators.«, Mervyn King
Was ist defensives Entscheiden, und warum ist es eines der größten Probleme unserer modernen Welt?
»Der Arzt ist nicht in einer Situation, dem Patienten das Beste zu empfehlen. Viele Ärzte fürchten, dass die Patienten klagen, insbesondere, wenn etwas unterlassen wurde. Die Patienten klagen nicht, wenn unnötige Operationen vorgenommen wurden.«
Weniger kann oft mehr sein:
»Viele Menschen denken — auch in der Wissenschaft — mehr ist immer besser.«
Dabei gilt in den meisten Fällen, gerade auch dort, wo wir häufig versuchen, komplexe Modelle anzuwenden:
»Je größer die Unsicherheit ist, umso einfacher muss man die Regulierung [oder das Modell] machen.«
Eine Erkenntnis, die im Grunde jedem klar ist, der sich mit der Steuerung komplexer Systeme auseinandersetzt. Warum handeln wir stetig dagegen?
»Wir brauchen eine Welt, die den Mut hat zur Vereinfachung.«
Und dann gibt es noch den Aspekt der Rückkopplung von (schlechten) Modellen auf die Welt, die sie vermeintlich beschreiben oder vorhersagen, und wir kommen leicht in einen Teufelskreis der zirkulären und selbstverstärkenden Fehler. Wie lassen sich diese vermeiden?
Was wird die Folge sein, wenn diese Formen der Modellierung und Verhaltenssteuerung auf eine immer totalitärere und total überwachte Gesellschaft trifft?
Entwickeln wir uns aber in der Realität mit künstlicher Intelligenz, Large Language Models und IT-getriebener Automatisierung, aber nicht gerade ins Gegenteil? Eine Welt, deren Entscheidungen von immer komplexeren Systemen intransparent getroffen werden, wo niemand mehr nachvollziehen oder bewerten und in Wahrheit verantworten kann, ob diese Entscheidungen sinnvoll sind? Denken wir beispielsweise an Modelle, die Rückfallwahrscheinlichkeiten von Straftätern bewerten.
»Viele Menschen lächeln über altmodische Wahrsager. Doch sobald die Hellseher mit Computern arbeiten, nehmen wir ihre Vorhersagen ernst und sind bereit, für sie zu zahlen.«
Zu welcher Welt bewegen wir uns hin? Zu einer, in der wir radikale Unsicherheit akzeptieren und entsprechen handeln, oder einer, wo wir uns immer mehr der Illusion von Kontrolle, Vorhersagbarkeit und Steuerbarkeit verlieren?
»In einer Welt, in der Technik (vermeintlich) smart wird, brauchen wir vor allem eines, nämlich Menschen, die auch smart werden. Also Menschen, die mitdenken, die sich nicht zurücklehnen und konsumieren; die sich nicht auf das reduzieren lassen, was man ihnen empfiehlt.«
Und zum Ende macht Prof. Gigerenzer noch den wichtigsten Aufruf der heutigen Zeit:
Mitdenken!
Denn es gilt:
»The world is inherently uncertain and to pretend otherwise is to create risk, not to minimise it.«, Mervyn King
Referenzen
Andere Episoden
-
Episode 121: Künstliche Unintelligenz
-
Episode 118: Science and Decision Making under Uncertainty, A Conversation with Prof. John Ioannidis
-
Episode 112: Nullius in Verba — oder: Der Müll der Wissenschaft
-
Episode 109: Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr
-
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
-
Episode 106: Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
-
Episode 99: Entkopplung, Kopplung, Rückkopplung
-
Episode 92: Wissen und Expertise Teil 2
-
Episode 80: Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion
-
Episode 79: Escape from Model Land, a Conversation with Dr. Erica Thompson
Prof. Gerd Gigerenzer
Fachliche Referenzen
- Gerd Gigerenzer, Bauchentscheidungen: Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition, Goldmann (2008)
- Gerd Gigerenzer, Das Einmaleins der Skepsis: Über den richtigen Umgang mit Zahlen und Risiken, Piper (2015)
- Gerd Gigerenzer, Risiko: Wie man die richtigen Entscheidungen trifft, Pantheon (2020)
- Gerd Gigerenzer, Klick: Wie wir in einer digitalen Welt die Kontrolle behalten und die richtigen Entscheidungen treffen, Bertelsmann (2021)
- Gerd Gigerenzer, Smart Management: Mit einfachen Heuristiken gute Entscheidungen treffen, Campus (2025)
- Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, langsames Denken, Siedler Verlag (2012)
- Gerd Gigerenzer, The rationally wars: a personal reflection, BPP (2024)
- Konstantinos Katsikopoulos, Gerd Gigerenzer et al, Transparent modeling of influenza incidence: Big data or a single data point from psychological theory?, International Journal of Forecasting (2022)
-
Mervyn King, John Kay, Radical Uncertainty, Bridge Street Press (2021)
-
Rory Sutherland, Alchemy, WH Allen (2021)
- Peter Kruse, next practice. Erfolgreiches Management von Instabilität. Veränderung durch Vernetzung, Gabal (2020)
- John P. Ioannidis, Forecasting for COVID-19 has failed, International Journal of Forecasting (2022)

Thursday Mar 20, 2025
Thursday Mar 20, 2025
Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts! In dieser Episode begrüße ich den renommierten Experten Franz Josef Radermacher vor einem besonderen Gast an der Wand: Albert Einstein. Was hat Einstein mit Energie zu tun? Warum ist Energie die Grundlage menschlichen Wohlstands? Und wie gestalten wir eine nachhaltige Zukunft in einer global vernetzten Welt? Dieses Gespräch nimmt uns mit auf eine Reise durch die Geschichte der Energienutzung, die Herausforderungen der Energiewende und die geopolitischen Dimensionen, die oft übersehen werden.
Prof. Radermacher ist Vorstand des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung, stellv. Vorstandsvorsitzender von Global Energy Solutions e. V. (Ulm), emerit. Professor für Informatik, Universität Ulm, 2000 – 2018 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI); er ist Ehrenpräsident des Ökosozialen Forum Europa, Wien, Mitglied des UN-Council of Engineers for the Energy Transition (CEET) sowie Mitglied des Club of Rome, Winterthur.
Was hat Einstein mit diesem Gespräch zu tun? Wir beginnen mit der Frage, welche Rolle Energie in unserer Gesellschaft spielt sowie der Tatsache, dass vielen Menschen, vermutlich den meisten, nicht klar ist, was unsere Gesellschaft antreibt? So waren 2023 mehr als 81 Prozent des gesamten weltweiten Energieverbrauchs durch fossile Quellen gedeckt, und die Menge an fossilen Energieträgern wächst ständig.
Wie hat Energie die Menschheit geprägt? Welche Energiequellen hatten wir früher und welchen Einfluss hatte die Veränderung der Energieträger auf unsere Gesellschaft und unseren Lebensstandard? Warum dominieren fossile Brennstoffe heute noch? Kann Energie Armut bekämpfen? Ist es Energie, die Wohlstand schafft?
Warum sind zwei oft übersehene Parameter von so großer Bedeutung: Energiedichte und Platzbedarf? Kernkraftwerke benötigen wenig Fläche im Vergleich zu Windrädern oder Photovoltaik:
»Da ist ja ein Faktor 100 dazwischen.« […] »Weil auch Fläche ein extrem knappes Gut ist, ist es problematisch, wenn man eine Energie mit ziemlich niedriger Dichte hat.«
Gleichzeitig sind Energie und Emissionen, besonders Treibhausgase, globale Phänomene, die lokal nicht zu lösen sind.
»Von 2004 bis 2023 haben die globalen Investitionen in Wind und Solar rund 4 Billionen Dollar ausgemacht, und trotzdem sind die fossilen Energieträger dreimal schneller gewachsen.“ Zudem: „In den großen Industrienationen […] eine Reduktion der CO2-Emissionen, aber gleichzeitig einen Zuwachs in Indien und China, der diese Reduktionen um das Faktor 5 überschattet.«, Robert Bryce
Überrascht uns China? China hat mittlerweile die EU auch in den Pro-Kopf-Emissionen überholt. Was passiert, wenn Schwellenländer folgen?
»An China kann man erkennen, was passiert, wenn ein armes Land versucht, Wohlstand aufzubauen. Und das geht bis heute nur mit fossilen Energieträgern.«
Sind schnelle Lösungen gefährlich? Großinfrastruktur, Energiesysteme sind immer eine Frage von Jahrzehnten. Wenn wir versuchen, Dinge hier über das Knie zu brechen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie große und extrem teure Fehler machen, enorm. Außerdem stellt sich die Frage, welche Relevanz Europa überhaupt noch hat?
Welche Maßnahmen gegen den Klimawandel könnten erfolgreich sein? Was wurde etwa in Baku beschlossen? Funktionieren Transferzahlungen? Warum scheitert eine Renewables Only Strategie zwangsläufig?
»Die Idee, Renewables Only, ist ja eine von Deutschland immer wieder propagierte Idee.[… Es] ist nur eine Methode, [Entwicklungsländer] arm zu halten«
Aber was ist die Alternative? Was ist Carbon Capture? Was ist die Rolle von Kernkraft? Welche Mischung verschiedener Verfahren ist sinnvoll?
Zuletzt diskutieren wir über Strom vs. Moleküle und den All-Electric-Irrtum. Damit verbunden ist der Irrglaube, Wasserstoff könnte das Renable-Desaster lösen.
Welche geopolitischen Herausforderungen sind mit diesen Themen verknüpft? Ist Prof. Radermacher optimistisch — für Europa, die Welt? Was könnte man jungen Menschen empfehlen?
Referenzen
Andere Episoden
-
Episode 109: Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr
-
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
-
Episode 95: Geopolitik und Militär, ein Gespräch mit Brigadier Prof. Walter Feichtinger
-
Episode 94: Systemisches Denken und gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Gespräch mit Herbert Saurugg
-
Episode 86: Climate Uncertainty and Risk, a conversation with Dr. Judith Curry
-
Episode 81: Energie und Ressourcen, ein Gespräch mit Dr. Lars Schernikau
-
Episode 73: Ökorealismus, ein Gespräch mit Björn Peters
-
Episode 70: Future of Farming, a conversation with Padraic Flood
-
Episode 62: Wirtschaft und Umwelt, ein Gespräch mit Prof. Hans-Werner Sinn
Prof. Radermacher
- Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung/n
- Global Energy Solutions
- Prof. Radermacher im Vorstand der Global Energy Solutions
- All In: Energie und Wohlstand für eine wachsende Welt, Murmann (2024)
Fachliche Referenzen
- Vaclav Smil, How the World Really Works, Penguin (2022)
- Vaclav Smil, Net Zero 2050, Fraser Institute (2024)
- Robert Bryce, The Energy Transition Isn't (2023)
- Robert Bryce, Numbers Don’t Lie (2024)

Monday Mar 03, 2025
Monday Mar 03, 2025
In this episode, I had the privilege of speaking with John Ioannidis, a renowned scientist and meta-researcher whose groundbreaking work has shaped our understanding of scientific reliability and its societal implications. We dive into his influential 2005 paper, Why Most Published Research Findings Are False, explore the evolution of scientific challenges over the past two decades, and reflect on how science intersects with policy and public trust—especially in times of crisis like COVID-19.
John had and has major impacts in our understanding of medical research, research quality in general, public health and how to handle critical situations under limited knowledge. His work was and is highly influential and extraordinarily important for our understanding where medical science, but really, science in general is standing, how we dealt with the Covid crisis, and how we could get our act together again.
He is professor of medicine at Stanford, expert in epidemiology, population health and biomedical data science.
We begin with John taking us back to 2005, when he published his paper in PLOS Medicine. He explains how it emerged from decades of empirical evidence on biases and false positives in research, considering factors like study size, statistical power, and competition that can distort findings, and why building on shaky foundations wastes time and resources.
“It was one effort to try to put together some possibilities, of calculating what are the chances that once we think we have come up with a scientific discovery with some statistical inference suggesting that we have a statistically significant result, how likely is that not to be so?”
I propose a distinction between “honest” and “dishonest” scientific failures, and John refines this. What does failure really mean, and how can they be categorised?
The discussion turns to the rise of fraud, with John revealing a startling shift: while fraud once required artistry, today’s “paper mills” churn out fake studies at scale. We touch on cases like Jan-Hendrik Schön, who published prolifically in top journals before being exposed, and how modern hyper-productivity, such as a paper every five days, raises red flags yet often goes unchecked.
“Perhaps an estimate for what is going on now is that it accounts for about 10%, not just 1%, because we have new ways of massive… outright fraud.”
This leads to a broader question about science’s efficiency. When we observe scientific output—papers, funding—grows exponentially but does breakthroughs lag? John is cautiously optimistic, acknowledging progress, but agrees efficiency isn’t what it could be. We reference Max Perutz’s recipe for success:
“No politics, no committees, no reports, no referees, no interviews; just gifted, highly motivated people, picked by a few men of good judgement.”
Could this be replicated in today's world or are we stuck in red tape?
“It is true that the progress is not proportional to the massive increase in some of the other numbers.”
We then pivot to nutrition, a field John describes as “messy.” How is it possible that with millions of papers, results are mosty based on shaky correlations rather than solid causal evidence? What are the reasons for this situation and what consequences does it have, e.g. in people trusting scientific results?
“Most of these recommendations are built on thin air. They have no solid science behind them.”
The pandemic looms large next. In 2020 Nassim Taleb and John Ioannidis had a dispute about the measures to be taken. What happened in March 2020 and onwards? Did we as society show paranoid overreactions, fuelled by clueless editorials and media hype?
“I gave interviews where I said, that’s fine. We don’t know what we’re facing with. It is okay to start with some very aggressive measures, but what we need is reliable evidence to be obtained as quickly as possible.”
Was the medicine, metaphorically speaking, worse than the disease? How can society balance worst-case scenarios without paralysis.
“We managed to kill far more by doing what we did.”
Who is framing the public narrative of complex questions like climate change or a pandemic? Is it really science driven, based on the best knowledge we have? In recent years influential scientific magazines publish articles by staff writers that have a high impact on the public perception, but are not necessarily well grounded:
“They know everything before we know anything.”
The conversation grows personal as John shares the toll of the COVID era—death threats to him and his family—and mourns the loss of civil debate. He’d rather hear from critics than echo chambers, but the partisan “war” mindset drowned out reason. Can science recover its humility and openness?
“I think very little of that happened. There was no willingness to see opponents as anything but enemies in a war.”
Inspired by Gerd Gigerenzer, who will be a guest in this show very soon, we close on the pitfalls of hyper-complex models in science and policy. How can we handle decision making under radical uncertainty? Which type of models help, which can lead us astray?
“I’m worried that complexity sometimes could be an alibi for confusion.”
This conversation left me both inspired and unsettled. John’s clarity on science’s flaws, paired with his hope for reform, offers a roadmap, but the stakes are high. From nutrition to pandemics, shaky science shapes our lives, and rebuilding trust demands we embrace uncertainty, not dogma. His call for dialogue over destruction is a plea we should not ignore.
Other Episodes
-
Episode 126: Schwarz gekleidet im dunklen Kohlekeller. Ein Gespräch mit Axel Bojanowski
-
Episode 122: Komplexitätsillusion oder Heuristik, ein Gespräch mit Gerd Gigerenzer
-
Episode 116: Science and Politics, A Conversation with Prof. Jessica Weinkle
-
Episode 112: Nullius in Verba — oder: Der Müll der Wissenschaft
-
Episode 109: Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr
-
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
-
Episode 106: Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
-
Episode 103: Schwarze Schwäne in Extremistan; die Welt des Nassim Taleb, ein Gespräch mit Ralph Zlabinger
-
Episode 94: Systemisches Denken und gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Gespräch mit Herbert Saurugg
-
Episode 92: Wissen und Expertise Teil 2
-
Episode 90: Unintended Consequences (Unerwartete Folgen)
-
Episode 86: Climate Uncertainty and Risk, a conversation with Dr. Judith Curry
-
Episode 67: Wissenschaft, Hype und Realität — ein Gespräch mit Stephan Schleim
References
- Prof. John Ioannidis at Stanford University
- John P. A. Ioannidis, Why Most Published Research Findings Are False, PLOS Medicine (2005)
- John Ioannidis, A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, weare making decisions without reliable data (2020)
- John Ioannidis, The scientists who publish a paper every five days, Nature Comment (2018)
- Hanae Armitage, 5 Questions: John Ioannidis calls for more rigorous nutrition research (2018)
- John Ioannidis, How the Pandemic Is Changing Scientific Norms, Tablet Magazine (2021)
- John Ioannidis et al, Uncertainty and Inconsistency of COVID-19 Non-Pharmaceutical1Intervention Effects with Multiple Competitive Statistical Models (2025)
- John Ioannidis et al, Forecasting for COVID-19 has failed (2022)
- Gerd Gigerenzer, Transparent modeling of influenza incidence: Big data or asingle data point from psychological theory? (2022)
- Sabine Kleinert, Richard Horton, How should medical science change? Lancet Comment (2014)
- Max Perutz quotation taken from Geoffrey West, Scale, Weidenfeld & Nicolson (2017)
- John Ioannidis: Das Gewissen der Wissenschaft, Ö1 Dimensionen (2024)

Monday Jan 27, 2025
116 — Science and Politics, A Conversation with Prof. Jessica Weinkle
Monday Jan 27, 2025
Monday Jan 27, 2025
Todays guest is Jessica Weinkle, Associate Professor of Public Policy at the University of North Carolina Wilmington, and Senior Fellow at The Breakthrough Institute.
In this episode we explore a range of topics and we start with the question: What is ecomodernism, and how does The Breakthrough Institute and Jessica interpret it?
“It's not a movement of can'ts”
Why are environmentalists selective about technology acceptance? Why do we assess ecological impact through bodies like the IPCC and frameworks like Planetary Boundaries? Are simplified indicators of complex systems genuinely helpful or misleading?
Is contemporary science more about appearances than substance, and do scientific journals serve more and more as advocacy platforms than fact-finding missions? How much should activism and science intersect? To what extent do our beliefs influence science, and vice versa, especially when financial interests are at play in fields like climate science? Can we trust scientific integrity when narratives are tailored for publication, like in the case of Patrick Brown?
What responsibilities do experts have when consulting in political spheres, and should they present options or advocate for specific actions? How has research publishing turned into big business, and what does this mean for the pursuit of truth?
“Experts should always say: here are your options A, B, C...; not: I think you should do A”
How does modeling shape global affairs? When we use models for decision-making, are we taking them too literally, or should we focus on their broader implications?
“To take a model literally is not to take it seriously […] the models are useful to give us some ideas, but the specificity is not where we should focus.”
What's the connection between scenario building, modeling, and risk management?
“There is an institutional and professional incentive to make big claims, to draw attention. […] That's what we get rewarded for. […] It does create an incentive to push ideas that are not necessarily the most helpful ideas for addressing public problems.”
How does the public venue affect scientists, and does the incentive to make bold claims for attention come at the cost of practical solutions? What lessons should we have learned from cases like Jan Hendrik Schön, and why haven't we?
“There is an underappreciation for the extent to which scholarly publishing is a business, a big media business. It's not just all good moral virtue around skill and enlightenment. It's money, fame and fortune.”
Finally, are narratives about future scenarios fueling climate anxiety, and how should we address this in science communication and policy-making?
“There is a freedom in uncertainty and there is also an opportunity to create decisions that are more robust to an unpredictable future. The more that we say we are certain ... the more vulnerable we become to the uncertainty that we are pretending is not there.”
Other Episodes
- Episode 109: Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr
-
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
-
Episode 90: Unintended Consequences (Unerwartete Folgen)
-
Episode 86: Climate Uncertainty and Risk, a conversation with Dr. Judith Curry
-
Episode 79: Escape from Model Land, a Conversation with Dr. Erica Thompson
-
Episode 76: Existentielle Risiken
-
Episode 74: Apocalype Always
-
Episode 70: Future of Farming, a conversation with Padraic Flood
-
Episode 68: Modelle und Realität, ein Gespräch mit Dr. Andreas Windisch
-
Episode 60: Wissenschaft und Umwelt — Teil 2
-
Episode 59: Wissenschaft und Umwelt — Teil 1
References
- Jessica Weinkle
- The Breakthrough Journal
- Planetary Boundaries (Stockholm Resilience Centre)
- Patrick T. Brown, I Left Out the Full Truth to Get My Climate Change Paper Published, The FP (2023)
- Roger Pielke Jr., What the media won't tell you about . . . hurricanes (2022)
- Roger Pielke Jr., "When scientific integrity is undermined in pursuit of financial and political gain" (2023)
- Many other excellent articles Roger Pielke on his Substack The Honest Broker
- Jessica Weinkle, Model me this (2024)
- Jessica Weinkle, How Planetary Boundaries Captured Science, Health, and Finance (2024)
- Jessica Weinkle, Bias. Undisclosed conflicts of interest are a serious problem in the climate change literature (2025)
- Marcia McNutt, The beyond-two-degree inferno, Science Editorial (2015)
- Scientific American editor quits after anti-Trump comments, Unherd (2024)
-
Erica Thompson, Escape from Model Land, Basic Books (2022)

Thursday Dec 26, 2024
Thursday Dec 26, 2024
This is episode 2 with conversations from the Liberty in our Lifetime Conference. Please start with the first part; show notes and references also with episode 1.

Tuesday Dec 17, 2024
Tuesday Dec 17, 2024
This episode is a special one as it brings you my impressions from the Liberty in Our Lifetime Conference held in Prague from November 1 to 3. Unlike my usual format of monologues or single guest interviews, this episode features brief conversations with six presenters from the conference, split into two parts.
In this first part, I speak with Massimo Mazzone about building a blue-collar Free City in Honduras, followed by discussions with urban economist Vera Kichanova, and Tatiana Butanka, who shares insights on the Free Community of Montelibero.
The conference, which generally leans towards libertarian ideas, showcases an astounding range of initiatives aimed at enhancing liberty in society.
I explore why successful societies should embrace explorers and risk-takers, questioning whether today's fear of challenging the status quo contradicts a progressive mindset. This aligns with Tatiana Butanka's appreciation for the variety of projects that are present at this conference and Lauren Razavi's call for the need of
"revolutionary thinking with evolutionary approaches."
Part two (Episode #114) will continue with conversations with Lauren Razavi, who is building an online country for digital nomads, Grant Romundt, discussing his project on floating homes, and Peter Young from the Free Cities Foundation, reflecting on free cities and the conference's outcomes.
I emphasize the importance of experimentation in dynamic societies, suggesting that progress relies on educated experiments and unique ideas, some of which will succeed, fail, or at least inspire. The discussions explore the balance between collective action and individual liberty, questioning if modern democracies have swung too far towards government control.
Two additional remarks:
- No financial advice is given, despite mentions of new financial instruments in some conversations.
- For full disclosure: I received a free ticket for the conference.
Other Episodes
-
Episode 108: Freie Privatstädte Teil 2, ein Gespräch mit Titus Gebel
-
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
-
Episode 88: Liberalismus und Freiheitsgrade, ein Gespräch mit Prof. Christoph Möllers
-
Episode 58: Verwaltung und staatliche Strukturen — ein Gespräch mit Veronika Lévesque
-
Episode 77: Freie Privatstädte, ein Gespräch mit Dr. Titus Gebel
-
Episode 44: Was ist Fortschritt? Ein Gespräch mit Philipp Blom
References
- Liberty in Our Lifetime Conference
- Massimo Mazzone
- Tatiana Butanka
- Vera Kichanova
- Lauren Razavi
- Grant Romundt
- Peter Young
- Free Cities Foundation

Tuesday Oct 29, 2024
110 — The Shock of the Old, a conversation with David Edgerton
Tuesday Oct 29, 2024
Tuesday Oct 29, 2024
This is again an exceptional conversation. For a long time, I looked forward to speaking with Prof. David Edgerton. He is currently a Fellow at the Wissenschaftskolleg zu Berlin and Hans Rausing Professor of the History of Science and Technology at King's College London. He is a noted historian of the United Kingdom as well as historian of technology and science. In the latter field he is best known for the book “Shock of the Old” which has been translated into many languages. He is also known in the UK for his commentaries on political and historical matters in the press. He is also a Fellow of the British Academy.
I read this book some years ago, and it left quite an impression on me. We talk about technology, or rather, why the word should not be used, about progress and stagnation; what role technology plays in societal change, if we really live in an age with an unseen pace of innovation, and much more.
We start with the question of how the book title “Shock of the Old” came about. What does the term “technology” mean, how does it relate to other terms like “technium” or the German terms “Technologie” and “Technik”, and why is it a problematic term?
“Technology is a very problematic concept, and if I would write the book again, I would not use the term. […] Technology is a concept that macerates the brain as it conflates multiple concepts.”
What is creole technology? Did we experience 50 years of unseen progress, or rather stagnation? How can we understand the reference of David Deutsch comparing the Solvay Conference 100 years ago with the current state of physics? Are we rather experiencing what Peter Kruse compares to a crab basket:
“There's always a lot of momentum in a crab basket, but on closer inspection, you realise that nothing is really moving forward.”, Peter Kruse
Can the 20th century be considered the playing out of the 19th century? What about the 21st century? Is technological change the driver of all change, or is technical change only one element of change in society? Does the old disappear? For instance, Jean-Baptiste Fressoz describes the global energy consumption in his book More and More and More.
“There has not been an energy transition, there has been a super-imposition of new techniques on old ones. […] We are living in the great age of coal.”
What is the material constitution of our world today? For example, Vaclav Smil makes it apparent, that most people have a quite biased understanding of how our world actually works.
How can change happen? Do we wish for evolution, or rather a revolution?
“The world in which we find ourselves at the start of the new millennium is littered with the debris of utopian projects.”, John Gray
Can technological promise also be a reason for avoiding change?
“Technological revolution can be a way of avoiding change. […] There will be a revolution in the future that will solve our problems. […] Relying only on innovation is a recipe for inaction.”
Do technologists tend to overpromise what their technology might deliver? For instance, the trope that this new technology will bring peace can be found over centuries.
Is maintenance an underestimated topic in out society and at universities? What role does maintenance play in our modern society in comparison to innovation? For example, Cyrus W. Field who built the first transatlantic cable between the US and UK proclaimed in an address to the American Geographical and Statistical Society in 1862
“its value can hardly be estimated to the commerce, and even to the peace, of the world.”
What is university knowledge, where does it come from, and how does it relate to knowledge of a society? How should we think about the idea of university lead innovation?
“There is a systematic overestimation of the university.”
Is there a cult of the entrepreneur? Who is actually driving change in society? Who decides about technical change? Moreover, most innovations are rejected:
“We should reject most of innovation; otherwise we are inundated with stuff.”
Are me even making regressions in society — Cory Doctorow calls it enshittification?
“We’re all living through a great enshittening, in which the services that matter to us, that we rely on, are turning into giant piles of shit. It’s frustrating. It’s demoralising. It’s even terrifying.”, Cory Doctorow
What impact will artificial intelligence have, and who controls the future?
“Humans are in control already. The question is which human.”
References
Other Episodes
- other English episodes
-
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
-
Episode 100: Live im MQ, Was ist Wissen. Ein Gespräch mit Philipp Blom
-
Episode 92: Wissen und Expertise Teil 2
-
Episode 80: Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion
-
Episode 91: Die Heidi-Klum-Universität, ein Gespräch mit Prof. Ehrmann und Prof. Sommer
-
Episode 88: Liberalismus und Freiheitsgrade, ein Gespräch mit Prof. Christoph Möllers
-
Episode 71: Stagnation oder Fortschritt — eine Reflexion an der Geschichte eines Lebens
-
Episode 45: Mit »Reboot« oder Rebellion aus der Krise?
-
Episode 38: Eliten, ein Gespräch mit Prof. Michael Hartmann
-
Episode 35: Innovation oder: Alle Existenz ist Wartung?
-
Episode 18: Gespräch mit Andreas Windisch: Physik, Fortschritt oder Stagnation
Dr. David Edgerton...
- ... at Wissenschaftskolleg zu Berlin
- ... at King's College London
- ... at Centre for the History of Science, Technology and Medicine
- ... at the British Academy
- Personal Website
- ... on X
- David Edgerton, The Shock Of The Old: Technology and Global History since 1900, Profile Books (2019)
Other References
- David Graeber, Peter Thiel, Where Did the Future Go (2020)
- Conversations with Coleman, Multiverse of Madness with David Deutsch (2023)
- Peter Kruse, next practice. Erfolgreiches Management von Instabilität. Veränderung durch Vernetzung, Gabal (2020)
- Jean-Baptiste Fressoz, More and More and More: An All-Consuming History of Energy, Allen Lane (2024)
-
Vaclav Smil, How the World Really Works, Penguin (2022)
-
John Gray, Black Mass, Pengui (2008)
- Ainissa Ramirez, A Wire Across the Ocean, American Scientist (2015)
-
Thomas Sowell, intellectuals and Society, Basic Books (2010)
- Peter Thiel Fellowship
- Cory Doctorow, ‘Enshittification’ is coming for absolutely everything, Financial Times (2024)