Episodes

Monday Aug 11, 2025
131 — Wot Se Fack, Deutschland? Ein Gespräch mit Vince Ebert
Monday Aug 11, 2025
Monday Aug 11, 2025
Offensichtlich habe ich Vince Ebert bei unserem letzten Gespräch nicht hinreichend abgeschreckt. Ich habe tatsächlich erneut die Freude, ihn zu einem Gespräch begrüßen zu dürfen! Der Titel der heutigen Episode folgt dem Buchtitel seines neuen Buches: »Wot Se Fack, Deutschland?« und statt Deutschland könnte ebenso – wie Vince Ebert im Gespräch erwähnt – Österreich stehen.
Vince Ebert ist Diplom-Physiker und Kabarettist seit über 25 Jahren. In der ARD moderierte er jahrelang die Sendung „Wissen vor Acht“. Seine Bücher sind Bestseller und haben sich über eine Million Mal verkauft. Außerdem ist er einer der gefragtesten Vortragsredner Deutschlands.
Das Buch von Vince Ebert erscheint am 14. August 2025, und ich wünsche an dieser Stelle natürlich viel Erfolg, denn dieses Buch ist es wert, gelesen zu werden!
Weiters möchte ich erwähnen, dass zwischen der Aufnahme unseres Gesprächs und der Veröffentlichung bekannt wurde, dass Vince Ebert mit der Hayek-Medaille 2025 ausgezeichnet wird. – Herzliche Gratulation dazu!
Diese Episode kreist um die Themen seines neuen Buches, beschränkt sich aber nicht darauf. Ich stelle zunächst die Frage, ob das Buch nachdenklicher als die früheren ist – oder ärgerlicher – oder ist es etwa eher Fassungslosigkeit, die man herausliest? Werfen wir unsere westlichen Werte und Errungenschaften ohne Not aus dem Fenster?
»Tagtäglich prasseln Meldungen auf uns ein, die immer absurder, bizarrer und bedrückender werden.«
Warum bestätigen viele Menschen die Probleme und die Verrücktheit der Situation in Vier-Augen-Gesprächen, sind aber nicht bereit, dies im täglichen Leben auszudrücken und zu verändern?
Gibt es wieder – wie früher in der DDR – eine private und eine öffentliche Meinung, die sich komplett von der privaten Meinung unterscheidet? Wie kann der Weckruf aussehen, um die Menschen, die den Großteil der Bevölkerung ausmachen, aus dieser Angststarre zu befreien?
Wird der Sturm gar über uns hinwegziehen, wenn die Mehrheit der Menschen sich duckt und stillhält?
Warum schweigen führende Manager, wenn offensichtlich verheerende Ideen in der Politik umgesetzt werden?
»The fraud investigator Bill Black had coined the concept of a ‘criminogenic organisation’. It referred to an institution in which incentives and management systems were structurally designed to ensure that crimes would be committed.«, Dan Davies
Müssen Mitarbeiter und Bürger zunehmend die Feigheit des opportunistischen Managements ausbaden? Gibt es nicht auch im Alltag immer weniger Mut, seine Ansicht auszudrücken und sich schlechten Ideen entgegenzustellen – vom Elternabend bis zum beruflichen Umfeld?
Erleben wir einen solchen Tsunami an irren Ideen, dass die meisten Menschen davon überfordert sind? Gibt es eine Empörungserschöpfung?
»Das nimmt uns Satirikern eigentlich den Job weg.«
Kommen wir in ein neues Biedermeier? Werden die Narren, die häufig die Deutungshoheit zu haben scheinen, dadurch noch kecker?
»Wenn die Vernünftigen den Diskurs verlassen, überlassen sie den Narren das Feld.«
Die Krise, die wir erleben, scheint noch dazu im Kern hausgemacht und eben nicht von großen externen Problemen getrieben zu sein. Wie ist das zu erklären?
Was sind die drei großen Baustellen, die wir nach wie vor ignorieren und die das Potenzial haben, unsere Nationen zu zerstören?
- Bürokratie (»Wir müssen da jetzt eine Kommission gründen, für Bürokratieabbau«)
- Energieversorgung (siehe auch frühere Episode mit Vince Ebert)
- Migration (in beide Richtungen)
Was war die Rolle der Merkel-Regierung ab ca. 2011? Hat sie die Schienen für die heutige tiefe Krise gelegt? Neben der politischen Dimension gibt es aber auch die Frage, wer überhaupt noch als Experte gelten darf?
»Besonders die sogenannten Expertenrunden im Zuge der Diskussionen um Klima, Corona und Migration haben einen neuen Oberlehrertypus hervorgebracht. Dieser verkauft seine Weltanschauung als Wissenschaft, flankiert von latenter Aggressivität und einer kaum zu überbietenden Überheblichkeit, mit der alle diejenigen abserviert werden, die es wagen, zu widersprechen oder auch nur Nachfragen zu stellen.«
Expertise wird gerade auch an Unis gesucht, aber was ist an den Unis los? Wie ist es zur starken Politisierung der Wissenschaft und der Uni-Landschaft gekommen? Ist das überhaupt ein neuer Trend? Sind Entscheidungen, etwa in Klima- oder Energiefragen, tatsächlich alternativlos, wie sie häufig dargestellt werden?
»Klimaforschung ist natürlich objektiv, wenn sie korrekt betrieben wird, aber Klimapolitik ist eine gesellschaftliche Frage. Da muss eine Gesellschaft darüber diskutieren.«
Wie ist das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Politik zu interpretieren?
»Man weiß dann immer nie, ob die Politik sich die Wissenschafter raussucht, die eine passende Meinung vertreten, oder ob sich die Wissenschaftler politisiert und angepasst haben.«
Darf man sich über die qualitativ fragwürdigen Ergebnisse wundern, wenn Anreizsysteme eingerichtet werden, die Opportunität fördern? Werden politisch erwünschte Erkenntnisse gefordert, so ist das für den Wissenschaftsbetrieb fatal. Gibt es jedoch Unterschiede zwischen Geistes- und Naturwissenschaften?
Fahren Aktivisten eine »Bait and Switch«-Strategie – was ist darunter konkret zu verstehen?
Wem haben wir die woken Ideen zu verdanken? Welche Rolle spielt der Postmodernismus und davor die Entwicklungen der Naturwissenschaft und die Versuche, die Erfolge der Naturwissenschaft in die Geisteswissenschaften zu übernehmen (etwa im Rahmen des Wiener Kreises)?
»Das Schiff wird während der Fahrt laufend neu gebaut«, Otto Neurath
Geht es nicht mehr um Wahrheit, sondern nur noch um die (irrige) Idee, alles wäre eine Frage von Machtverhältnissen? Wenn alles eine Frage der Machtstruktur ist, dann habe ich kaum Verantwortung mehr, dann läuft mein Leben nicht rund, weil ich schlechte Entscheidungen getroffen habe, sondern weil mich das Machtsystem unterdrückt und meine Genialität nicht erkennen will. Ist das eine Perpetuierung einer selbstverursachten Opferrolle? Eine bequeme Möglichkeit, die Verantwortungsübernahme zu vermeiden?
In der Geschichte gab es Gegenbewegungen, etwa die Romantik – stecken wir in einer neuen Romantik fest? Alles Emotion, nichts real? Ist alles subjektiv und es gibt keine objektiven Wahrheiten – aber ist diese Behauptung nicht selbstwidersprüchlich? Wie weit ist der Weg von der Postmoderne zur völligen Beliebigkeit?
»1986 hat Herbert Grönemeyer gesungen: Kinder an die Macht. Und immer öfter denke ich: Sein Wunsch hat sich erfüllt.«
Die Umdefinition von Worten ist auch ein gängiges Machtmittel, wie Hayek schon 1945 festgestellt hat:
»Freiheit ist keineswegs das einzige Wort, dessen Bedeutung ins Gegenteil verkehrt worden ist, damit es zum tauglichen Instrument der totalitären Propaganda wird. Wir haben schon gesehen, wie dasselbe mit den Wörtern Gerechtigkeit, Gesetz, Recht und Gleichheit geschieht. Diese Liste könnte so lange fortgesetzt werden, bis sie fast alle gebräuchlichen Ausdrücke der Moral und der Politik umfasst.«
Werden uns Begriffe genommen oder durch stete Umdefinition wertlos gemacht, so werden uns auch Wege der Argumentation genommen. Ist es das, was wir gerade erleben?
So provoziert beispielsweise Jette Nietzard mit »Eat the Rich«-Kappe und »All Cops are Bastards«-Pullover – während andere Vertreter der Partei regelmäßig vor der vermeintlichen Bedrohung der Demokratie durch Hass und Hetze warnen. Ist Hass und Hetze immer Hass und Hetze der anderen?
Woher kommt diese Polarisierung in der Gesellschaft?
»Wir sind ein evolutionäres Produkt. Wir sind rationale Wesen und wir sind auch Gefühlswesen. Wir sind gruppenzentriert, wir sind Individualisten. Wir pendeln immer zwischen dieser Herdenmentalität und diesem individualistischen Selbstentfaltungstrieb.«
Gelingt es zu vielen Menschen, besonders auch Wissenschaftlern und »Experten«, sich dem Test ihrer Ideen an der Realität zu entziehen beziehungsweise den Folgen solcher Tests? Kurz gesagt: Immunisieren sie sich selbst gegen die Fehler, die andere machen, wenn sie den Theorien folgen?
Was ist von der These zu halten, dass das Behaupten offensichtlich absurder Ideen eine Demonstration von großer Macht sein kann, die Menschen noch dazu demütigt?
Wie steht es mit Rationalität und Glauben? Was macht eine Religion heute erfolgreich?
Wie steht es eigentlich um den Rest der Welt – ist dort der Drang, sich selbst abzuschaffen, ebenso groß wie in Europa?
»Die Welt wird natürlich besser – aber wir nehmen uns heraus.«
Wie läuft hingegen der Diskurs in weiten Bereichen deutscher Eliten?
»Hier zulande sprechen wir ganz liebevoll von Familienunternehmern – in anderen Ländern nennt man sie Oligarchen.«, Martyna Linartas
Wieso kämpfen wir im Westen mit solcher Inbrunst gegen genau die Dinge, die uns erfolgreich gemacht, die unseren Wohlstand begründet haben und um die uns die Welt beneidet — oder beneidet hat?
»Der große Vorteil der westlichen Kultur ist die Selbstreflexion, der Selbstzweifel. Nicht umsonst haben wir eine Erinnerungskultur. […] Da sind Dinge schlecht gelaufen, wir versuchen sie jetzt besser zu machen – und wir haben sie auch verbessert. In den letzten zwanzig Jahren ist diese Selbstkorrektur in Selbstverachtung und dieser Selbstzweifel in komplette Selbstzerstörung umgeschlagen. […] Das ist vielleicht das, was man Wohlstandsverwahrlosung nennt.«
Wann kommt es zu Kipppunkten in Gesellschaften?
»Diversität bedeutet, alle denken das Gleiche und sehen dabei unterschiedlich aus. Dabei sollte Diversität eigentlich eine Vielfalt in Meinungen und Ansichten bedeuten.«
Menschen reagieren auf Anreize. Wie kann man diese in unserer Gesellschaft aber verändern?
»You get what you reward for.«, Charlie Munger
Wie hat sich die Rolle des Staates verändert – haben wir unsere Freiheit aufgegeben, um einen Nanny-State zu schaffen? Kann das überhaupt funktionieren – selbst wenn wir gewillt sind, unsere Freiheit aufzugeben?
»Seit ich denken kann, überfrachten wir die Politik mit so hohen Erwartungen, dass sie nur scheitern kann.«
Ist es wirklich die Politik, die scheitert, oder ist es zu einem systemischen Problem geworden? Wie kann uns ein Blick über den Tellerrand helfen? Brauchen wir mehr liberales oder libertäres Gedankengut in Europa?
»Das Gegenteil von links und rechts ist liberal.«
In der Biologie lehnt die Moderne zurecht einen »intelligenten Designer« ab, aber in der Wirtschaft soll das funktionieren? Passt das zusammen? Hat Marktwirtschaft nicht in Wahrheit eine emanzipierende Wirkung? Fürchtet man sich davor? Brodeln in der Gesellschaft so stark Spannungen, dass wir vor neuen Kipppunkten stehen? Können wir das Schiff noch vor dem Eisberg umsteuern?
»Die Revolution hat schon immer ihre eigenen Kinder gefressen.«
Referenzen
Andere Episoden
-
Episode 130: Populismus und (Ordo)liberalismus, ein Gespräch mit Nils Hesse
-
Episode 128: Aufbruch in die Moderne — Der Mann, der die Welt erfindet!
-
Episode 126: Schwarz gekleidet im dunklen Kohlekeller. Ein Gespräch mit Axel Bojanowski
-
Episode 125: Ist Fortschritt möglich? Ideen als Widergänger über Generationen
-
Episode 118: Science and Decision Making under Uncertainty, A Conversation with Prof. John Ioannidis
-
Episode 117: Der humpelnde Staat, ein Gespräch mit Prof. Christoph Kletzer
-
Episode 113: Liberty in Our Lifetime 1: Conversations with Massimo Mazzone, Vera Kichanova and Tatiana Butanka
-
Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
-
Episode 101: Live im MQ, Macht und Ohnmacht in der Wissensgesellschaft. Ein Gespräch mit John G. Haas.
-
Episode 96: Ist der heutigen Welt nur mehr mit Komödie beizukommen? Ein Gespräch mit Vince Ebert
-
Episode 91: Die Heidi-Klum-Universität, ein Gespräch mit Prof. Ehrmann und Prof. Sommer
-
Episode 84: (Epistemische) Krisen? Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
Vince Ebert
Fachliche Referenzen
-
Dan Davies, The Unaccountability Machine, Why Big Systems Make Terrible Decisions - and How The World Lost its Mind, Profile Books (2024)
- Wiener Kreis: In Our Time, Logical Positivism (2009)
-
Friedrich von Hayek, The Road to Serfdom, Routledge (1944)
-
Thomas Sowell, intellectuals and Society, Basic Books (2010)
-
James Burnham, The Managerial Revolution; What is Happening in the World, John Day Company (1941)

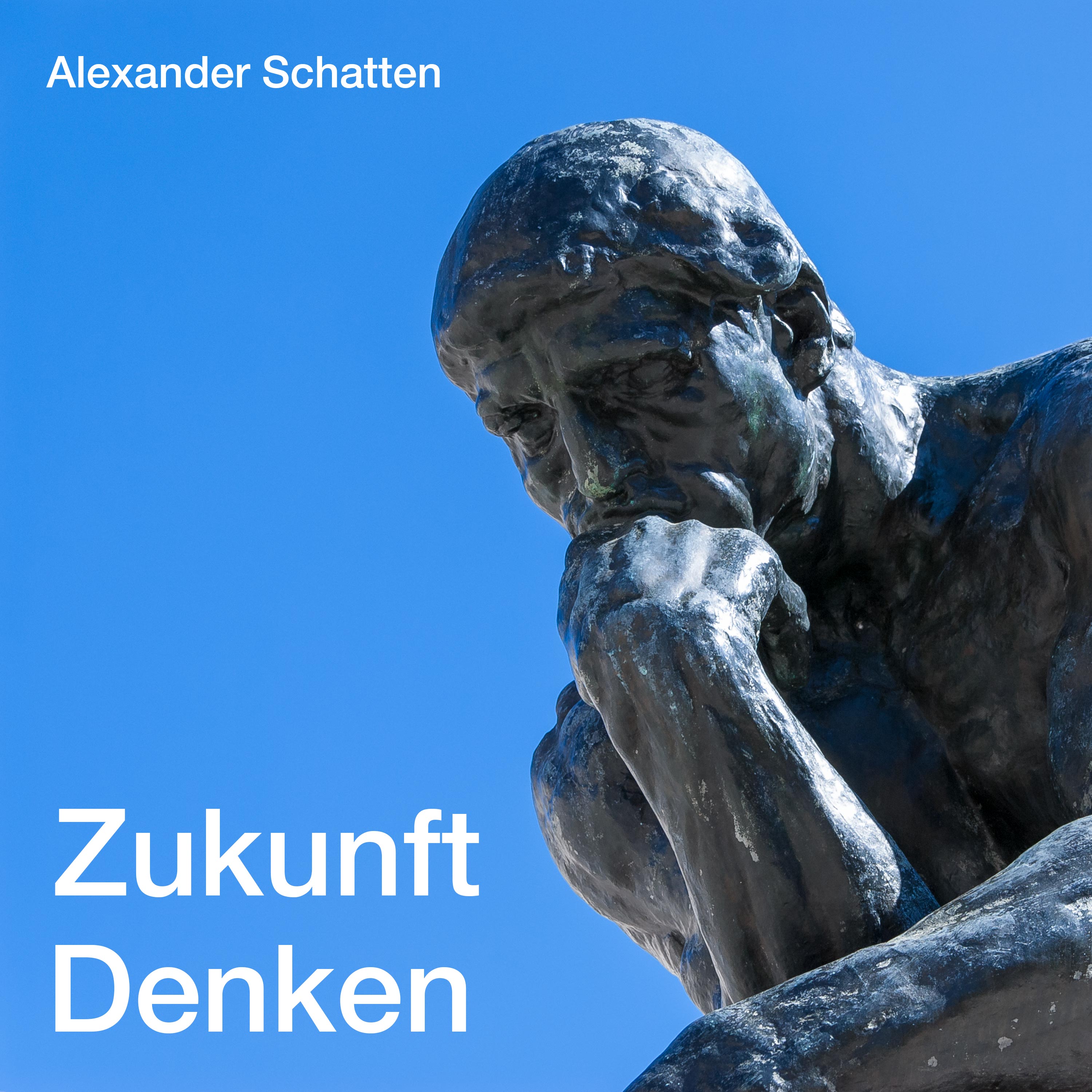
No comments yet. Be the first to say something!